„Es geht nicht nur um bunte Kostüme, Musik und Tanz – es geht um ein Stück Identität, das Generationen verbindet.“ Mit diesen Worten fasste Christoph Matthes, Präsident Landesverband Thüringer Karnevalvereine e.V., beim Ostkonvent 2024 die Motivation zusammen, gemeinsam eine Bewerbung für das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes auf den Weg zu bringen.
Nach mehr als einem Jahr intensiver Arbeit haben die fünf ostdeutschen Landesverbände (Brandenburg/Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) nun ihre Unterlagen eingereicht.
Ein langer Weg voller Stimmen
Der Prozess begann 2023 zur BDK-Meile in Erfurt und mit den Mitgliederversammlungen, bei denen Vertreterinnen und Vertreter aus allen Regionen beteiligt waren. „Wir wollten, dass jeder Verein, jede Stimme gehört wird“, sagt Projektleiter Mike Limmer. Ein Fragenkatalog sammelte systematisch Erfahrungen und Eigenheiten: von Zampern in der Lausitz über die Schifferfastnacht in Sachsen bis zum Erbsbär in Thüringen. Auch Chronisten, Büttenredner und Tanztrainer steuerten persönliche Geschichten bei.
Ein wichtiger Fundus waren Archive, Chroniken und Publikationen. Werke wie Hans Schuberts „Fastnachtliche Bräuche in Brandenburg und Berlin“ oder die Studie „Fasching und Karneval in der DDR“ halfen, die Entwicklung historisch einzuordnen. Abgestimmt wurden die Ergebnisse im Ostkonvent – dem Treffen, bei dem alle fünf Landesverbände jährlich ihre Positionen bündeln.
Geschichte zwischen Anpassung und Widerstand
Die Bewerbung zeichnet ein breites Bild: Erste Belege stammen aus dem 14. Jahrhundert, wie der „Unweise Rat“ in Königsee (1391) oder eine Wasunger Quittung über ein Fass Bier (1524). Vorchristliche Winteraustreibungsbräuche wie Zampern oder Strohbären verbanden sich mit dem Kirchenjahr.
Im 20. Jahrhundert war Karneval immer auch Spiegel seiner Zeit: Gleichschaltung im Nationalsozialismus, staatliche Kontrolle in der DDR. Dennoch entstanden gerade im Osten zahlreiche neue Clubs, oft in Betrieben. „Die Büttenrede war unsere Sprache zwischen den Zeilen“, erinnerte sich Martin Krieg. „Wir sagten Dinge, die im Alltag tabu waren – verpackt in Humor.“
Gegenwart: Vielfalt, Professionalität, Inklusion
Heute zählt der ostdeutsche Karneval rund 930 Vereine mit 95.000 Mitgliedern. Fast die Hälfte sind Kinder und Jugendliche – ein starkes Signal für die Zukunft. Tanzsport ist professionalisiert, Frauen führen Vereine, Menschen mit Behinderungen oder Migrationsgeschichte wirken selbstverständlich mit.
Prunksitzungen, Umzüge, Rathausstürme, Maskenbälle und Fastnachtsverbrennungen prägen die Saison von 11.11. bis Aschermittwoch. Regionale Eigenheiten – von Schifferfastnacht bis Strohbär – machen die Vielfalt aus.
Wissen weitergeben – Generation für Generation
In Garden lernen Kinder Haltung und Rhythmus, bei Nachwuchswettbewerben üben Jugendliche Redekunst. Handwerkliches Wissen fließt beim Wagen- und Kostümbau von Älteren zu Jüngeren. Musikzüge, Guggenmusik und Spielmannskapellen halten Melodien und Traditionen lebendig. Chroniken, Archive und digitale Sammlungen sichern Erinnerungen.
Ein Vereinschronist beschreibt es so: „Man kann Karneval nicht aus Büchern lernen. Man muss ihn erleben – beim Proben, beim Bauen, beim Feiern.“
Herausforderungen für die Zukunft
Doch die Bewerbung verschweigt auch Risiken nicht: Nachwuchsmangel bei Büttenrednern und Musikgruppen, steigende Kosten für Sicherheit und Hallen, wachsende Bürokratie. Figuren wie der Strohbär sind nur noch selten zu sehen. Polarisierung in der Gesellschaft erschwert satirische Rede, die traditionell Herzstück des Karnevals ist.
Die Corona-Pandemie brachte Brüche in Routinen, manche Mitglieder kehrten nicht zurück. Zugleich droht die Gefahr einer Kommerzialisierung, die regionale Eigenheiten verdrängen könnte.
Maßnahmen: Bewahren und neu erfinden
Die Bewerbung beschreibt eine Vielzahl von Erhaltungsmaßnahmen:
- Jugendarbeit durch Nachwuchsbütt-Wettbewerbe, Ferienlager, Jugendelferräte.
- Fortbildungen für Trainer, Redner, Musiker und Vereinsleitungen.
- Dokumentation durch digitale Archive, Zeitzeugeninterviews und Ausstellungen.
- Inklusion und Kooperation mit sozialen Trägern.
- Nachhaltigkeit im Wagenbau, Materialkreislauf und ökologische Konzepte.
- Vernetzung über Ostkonvent, Bund Deutscher Karneval und europäische Dachverbände (NEG, FECC).
Besonders hervorgehoben wird die Nachwuchsförderung in der Büttenrede. Junge Menschen lernen dort nicht nur Humor, sondern auch Sprachkompetenz, Selbstbewusstsein und Kritikfähigkeit – ein Programm, das als „Good-Practice-Beispiel“ bundesweit Modellcharakter haben soll.
Europäische Vernetzung
Karneval ist ein europäisches Phänomen: Masken in Venedig, Umzüge in Nizza, Basler Fastnacht oder „Kurentovanje“ in Slowenien. Ostdeutschland ist über die NEG und die FECC eingebunden, Vereine pflegen Partnerschaften nach Österreich, Schweiz, Belgien und Luxemburg. Gegenseitige Besuche, Seminare und Jugendprojekte fördern Austausch und lebendige Weiterentwicklung.
Fazit
Mit der Bewerbung setzen die ostdeutschen Karnevalsverbände ein starkes Zeichen: Sie wollen nicht nur Tradition bewahren, sondern auch zeigen, dass Karneval ein lebendiges Kulturerbe ist – offen, vielfältig, zukunftsorientiert.
„Karneval ist Urlaub von sich selbst“, sagt LTK-Präsident Matthes. „Er ist Humor, Gemeinschaft und Kritik zugleich – und gerade deshalb so wichtig für unsere Gesellschaft.“








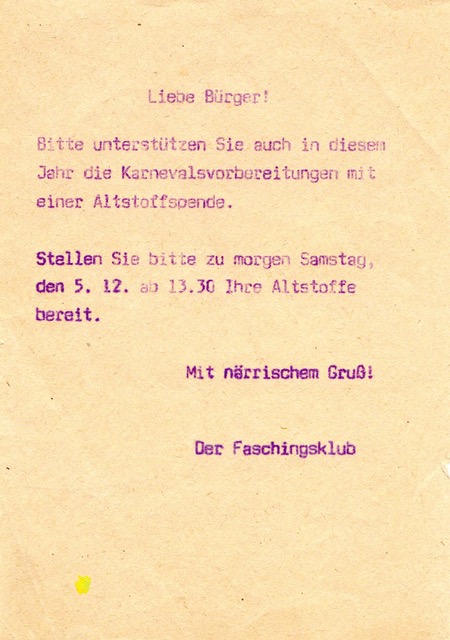
.
